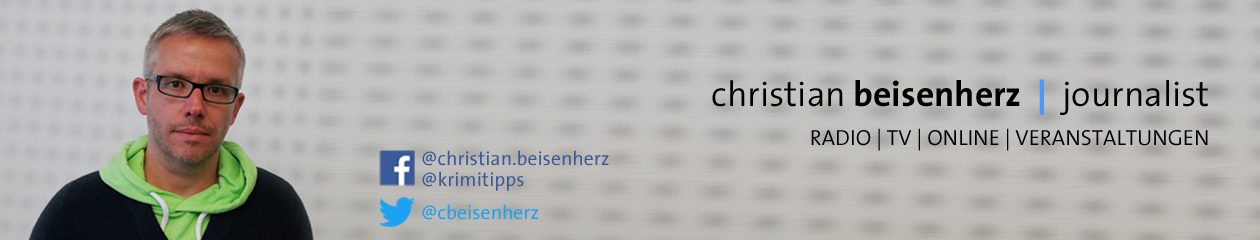Ein Gastbeitrag von Klemens Ketelhut, Lehrbeauftragter an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg im Arbeitsbereich historische Bildungsforschung und pädagogische Frauen- und Geschlechterforschung.
Manchmal weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Die aktuelle Debatte um eine zunehmende Sichtbarkeit von nicht-heterosexuellen Orientierungen oder Identitäten kommt mir wie eine trübe Suppe stereotyper Vorurteile vor, in der jedes Mittel zur Diskreditierung derjenigen, die eine Öffnung von Schulen und anderen Teilen der Gesellschaft befürworten, legitim zu sein scheint. Kindeswohl, Frühsexualisierung, Verlust kirchlicher Werte, Niedergang der Kultur und nicht zuletzt die große Rede über „Regenbogenideologie“ oder eine angebliche „Homo-Lobby“ werden, gern noch mit patriarchalen und völkischen Argumenten, in einen großen Ressentiments-Kessel gesteckt, der auf dem Scheiterhaufen von Demokratie, Aufklärung und Menschenrechten seinen Platz findet.
Das Problem solcher Debatten ist, zumindest meist, dass die eigentlichen Positionen verdeckt bleiben. Niemand kann ernsthaft glauben, dass eine Auseinandersetzung mit nicht-heterosexuellen Lebensweisen einen Menschen in seiner sexuellen Orientierung veränderte. Genausowenig wird niemand wirklich glauben können, dass Institutionen wie Ehe und Familie eine nachteilige Veränderung erfahren, wenn schlicht gesagt wird: Familie ist da, wo Kinder sind (Was in meinen Augen auch ein ziemliches Entgegenkommen bedeutet. Aber sei es drum). Was mich besonders und immer wieder irritiert, ist, dass viele Menschen sich darüber negativ äußern, dass „das Thema“ so viel diskutiert wird, dass „die Schwulen“ (und erstaunlicherweise nicht auch „die Lesben“ oder andere Gruppen) jetzt so öffentlich werden etc. In der Regel sind das Menschen, die selber heterosexuell sind. Und natürlich wird damit sofort offensichtlich, was das eigentliche Problem ist: Heterosexualität wird als „normal“ verstanden, und daher darf sie überall sichtbar sein. Sie ist so sichtbar, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen. Sie ist da. In der Werbung, im Haus nebenan, im Gespräch unter Kollegen und Freunden, im Internet. Überall. Gesetze befassen sich mit ihr. Institutionen sind heterosexuell. Tanten, Opas und Lehrer reden darüber. Diese Unsichtbarkeit wird dann sichtbar, wenn sie angegriffen wird. Wenn jemand gleichsam das Muster unterbricht. Wie eine Interferenz, die den so behaglichen Schein stört.
Das ist kein neues Phänomen. Man erinnere sich an Zeiten, in denen uneheliche Kinder verschrien wurden, unter Umständen sogar in Heime eingewiesen. Die Normalitätsvorstellung der heterosexuellen Kleinfamilie, die in diesen Diskussionen zur tatsächlichen Ideologie verkommen ist, wird durch die als antastbar deutlich, die sich ihr entziehen. Und so geschieht es auch mit der heterosexuell eingerichteten Welt. Je mehr darüber gesprochen wird, dass es auch anders sein kann, desto vehementer muss die scheinbare Normalität als solche wieder hergestellt und verteidigt werden. Und wenn die Ratio nicht mehr hilft, dann müssen die guten alten Letztbegründungen her: Natur, Gottes Wille oder das Volk. Dass diese austauschbar sind, ist offensichtlich. Anders kann man den immer wieder stattfindenden Schulterschluss zwischen bestimmten christlichen und rechtsgerichteten Gruppierungen nicht verstehen. Gleichzeitig sind sie aber das Gefährliche, das Schwierige und Problematische in diesen Diskussionen: Der Rekurs auf etwas nicht Hinterfragbares verhindert Auseinandersetzung. Und damit das vielleicht wichtigste, was eine Demokratie braucht: Diskurs. Das ändert sich auch nicht, wenn Menschen, die aus einer fundamentalchristlichen Überzeugung handeln, behaupten, dass sie als „besorgte Bürgerinnen und Bürger“ nicht gehört würden. Solange die Prämissen als solche nicht zu befragen sind, solange wird es keinen wirklichen Diskurs geben.
Genau das ist im Moment zu erkennen, und zwar an zwei Phänomenen: zum einen an der Hysterie, mit der Menschen sich gegen die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Homophobie zur Wehr setzen. Wie immer gern genommen dabei ist das angebliche „Kindeswohl“, dessen Gefährdung doch nur aus falsch verstandenen Inhalten argumentiert werden kann. Es ist – das sei bemerkt – erstaunlich, dass viele Menschen, wenn sie „Vielfalt“ hören, an „Sexualpraktiken“ denken und von dieser Verbindung auch offensichtlich nicht lassen können. Die immer wieder zu beobachtende Rede über eine drohende „Frühsexualisierung“ ist nur ein Indiz dafür. Dass das natürlich viel über diese einzelnen Menschen und ihr Verhältnis zu Sexualität aussagt, wird erstaunlich selten thematisiert. Dahinter verbergen sich kulturelle Stereotype wie zum Beispiel die Vorstellung, dass Homosexualität ansteckend wäre und nicht etwa eine Begehrensrichtung beschreibt, sondern nur als Bündel (möglichst extremer) Sexualpraktiken verstanden werden könne. Dass diese Haltung einer empirischen Beobachtung an keiner Stelle entspricht, scheint wiederum nicht denkbar. Und diese Auseinandersetzung wird nicht nur nicht gesucht – sie zu verhindern ist ja gerade der Kern dessen, dass ein Reden über unterschiedliches Begehren in Schule und Öffentlichkeit möglichst nicht stattfinden soll. Ebenso scheint – das wäre der zweite Punkt – es selten möglich, die Sicht derjenigen zu übernehmen, um die es geht. Dass Schwule und Lesben in einem hohen Ausmaß gesellschaftlicher Benachteiligung ausgesetzt sind, wird als falsche Behauptung abgetan und schlicht nicht ernstgenommen. Und damit ist nicht nur gemeint, dass es physische Gewalt gibt (und ich würde mich wirklich dafür interessieren, ob es heterosexuelle Paare gibt, die nur wegen der Tatsache, dass sie heterosexuell sind, angepöbelt, attackiert oder anderweitig ausgegrenzt wurden. Die sich überlegen, ob sie einen bestimmten Weg nach Hause laufen, weil der durch eine Gegend führt, die dafür bekannt ist, dass Heteros dort oft Gewalterfahrungen machen), sondern es ist viel kleinschrittiger: Menschen mit einer nicht-heterosexuellen Identität leben in einer Welt, die – siehe oben – sie kaum mitdenkt. In der sie erstmal fremd sind. Nicht genannt werden. Und wenn sie es doch tut, dann in wenig erfreulicher Weise. Ich bin sicher, jeder, der homosexuell begehrt, kennt Situationen, in denen er sich genau überlegt, ob er seine Begehrensrichtung offenbart. Ich kenne keinen Hetero, der sich darüber Gedanken machen müsste. Auch nicht darüber, was die Eltern sagen. Oder die Nachbarn oder die Kirchengemeinde. Ich würde mir für diese Debatte wünschen, dass sie weniger hysterisch und mit mehr Verstand geführt wird. Die aktuelle Emotionalisierung ist überhaupt nicht zielführend, dafür aber verletzend für die, die betroffen sind. Sie diskreditiert jene, die Ausgrenzungserfahrungen gemacht haben und verhindert, dass Stereotype und Vorurteile abgebaut werden
Share on Facebook